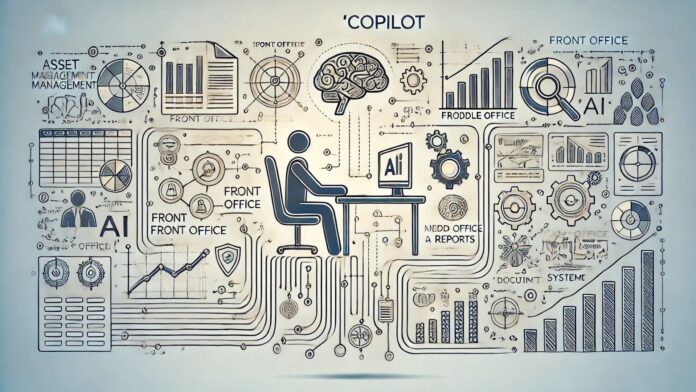Künstliche Intelligenz ist im Asset-Management von der Idee zur täglichen Praxis geworden. In den nächsten zwei Jahren unterstützen vorwiegend sogenannte Copilots die Arbeit in Research, Vertrieb und Reporting. In zwei bis fünf Jahren werden ganze Abläufe neu gedacht, und einzelne Softwareagenten übernehmen vorbereitende Schritte, während Menschen Entscheidungen treffen und verantworten. Ab fünf Jahren wandert ein großer Teil der wiederkehrenden Text- und Datenarbeit in automatisierte Pipelines. Der Wert entsteht dann primär durch gutes Urteilsvermögen, saubere Governance und die Fähigkeit, Daten und Modelle klug zu integrieren.
Kernbotschaft: Häuser, die jetzt Datenbasis, Zielbild und Governance klären, erzielen messbare Verbesserungen bei Produktivität und Qualität. Der Personalbestand muss dabei nicht sinken. Aufgaben verlagern sich jedoch deutlich.
Warum gerade jetzt Bewegung in den Markt kommt
Erstens: Reifere Werkzeuge. Sprachmodelle erstellen Texte, fassen Quellen zusammen, beantworten fachliche Fragen und unterstützen bei Analysen. Sie sind nicht perfekt, aber in vielen Büroprozessen bereits nützlich.
Zweitens: Hohe Dichte an Anwendungsfällen. Entlang der Wertschöpfungskette gibt es heute viele Aufgaben, die sich mit KI sinnvoll unterstützen lassen. Dazu zählen RFP und DDQ, strukturierte Meetingnotizen, Client-Reporting und die Erstprüfung von Marketingmaterialien.
Drittens: Mehr Klarheit bei der Aufsicht. Europäische und nationale Aufseher betonen die Verantwortung der Unternehmensleitung und verlangen nachvollziehbare Prozesse, Datenqualität und menschliche Kontrolle. Das schafft Planungssicherheit.
Kurzfristig: bis zwei Jahre
Front Office: In Research und Portfolio Management entstehen Zusammenfassungen von Earnings Calls und Prospekten in Minuten. Copilots erstellen Vergleichsanalysen und liefern erste Hypothesenskizzen. Im institutionellen Vertrieb helfen Vorlagen für RFP und DDQ, die zügig angepasst und rechtssicher freigegeben werden. Meeting Debriefs landen strukturiert im CRM und erzeugen To dos und Entwürfe für Follow-ups.
Middle Office: Risk und Performance erhalten vorbereitete Limitberichte, Hinweise auf Stilabweichungen und kurze Attributionserklärungen mit Quellenpfad. Compliance und Legal bekommen Checklisten und Erstprüfungen für Marketing und Kundenunterlagen. Die finale Freigabe bleibt beim Menschen.
Backoffice und Operations: Factsheets, KIDs und KIIDs, SFDR- und Taxonomie-Zuordnungen sowie Kommentarbausteine werden als Dokumentpakete erzeugt, versioniert und geprüft.
Ergebnis: Durchlaufzeiten sinken, Fehler gehen zurück, und es bleibt mehr Zeit für Kundengespräche und echte Analyse.
Mittelfristig: zwei bis fünf Jahre
Unternehmen stellen nicht nur Tools bereit, sondern gestalten Prozesse rund um KI neu. Mehrstufige Agenten beschaffen Daten, prüfen Qualität, vergleichen Peers, testen Hypothesen und liefern Vorlagen für Entscheidungen. Risk und Performance arbeiten stärker als kontinuierliche Absicherung, nicht nur als monatlicher Bericht. Governance-Artefakte wie Modellregister, Red-Teaming und Regeln für externe Anbieter sind dann gelebter Standard.
Langfristig: fünf Jahre und mehr
Ein großer Teil der wiederholbaren Recherche, Konsolidierung und Standardkommentierung läuft in automatisierten Ketten. Menschen bleiben aber verantwortlich für Entscheidung, Begründung und Ethik. Wettbewerbsvorteile entstehen durch Systemdenken, durchdachte Orchestrierung und erklärbare, robuste Modelle. Neue Produkte und Services werden von Anfang an KI-fähig gebaut.
Die Wertschöpfungskette im Detail
Portfolio Management, Research, Quant
- Reife Anwendungsfälle: Research-Copilots fassen Transkripte und Prospekte zusammen, erstellen Peer Analysen und liefern zitatfähige Auszüge. Portfolioassistenten zeigen Risiko- und Faktorprofile, warnen vor Stildrift und schlagen Rebalancings mit Begründung vor. Decision Journals dokumentieren den Gedankengang und helfen, typische Verzerrungen zu vermeiden.
- Nutzen: Schnellere Arbeitszyklen, mehr Abdeckung je Analystin oder Analyst und besser nachvollziehbare Kommunikation gegenüber Investoren.
Trading und Ausführung
- Anwendungsfälle: Pre-Trade-Checks, Liquiditätsscreens, Unterstützung bei der Analyse von Transaktionskosten sowie das Vorbefüllen von Tickets im Order-Management.
- Nutzen: Weniger manuelle Vorarbeit, klare Steuerung von Ausnahmen und ein sauberer Audit Trail.
Risk und Performance
- Anwendungsfälle: laufende Überwachung von Limits und Stil, automatische Erstellung von Attributionserklärungen, Was-wäre-wenn-Szenarien für Anlageausschüsse sowie kontinuierliche Absicherung.
- Nutzen: Kürzere Berichtsläufe und Fokus auf wesentliche Risiken statt auf manuelle Produktion.
Institutional Sales und Investor Relations
- Anwendungsfälle: RFP und DDQ mit Wissenshub und Vorlagen, personalisierte Briefings, strukturierte Meeting-Debriefs, Quartals- und Jahresgespräche mit vorbereitetem Material.
- Nutzen: Mehr Kundentermine pro Relationship-Manager, schnellere Antwortzeiten und konsistente Botschaften.
Compliance und Legal
- Anwendungsfälle: Erstprüfung von Marketingunterlagen, Hinweise zu internen Richtlinien, Verwaltung von Registern und Datenschutz-Folgenabschätzungen.
- Nutzen: Kürzere Durchlaufzeiten und frühzeitige Risikoerkennung, bei unveränderter Verantwortung der Unternehmensleitung.
Operations, Transfer Agency, Reporting
- Anwendungsfälle: Dokumentfabriken für Factsheets, KIDs, SFDR-Texte und Kommentare, systematische Datenqualitätsprüfungen und eindeutiges Exception-Handling.
- Nutzen: Weniger Fehler, transparente Versionierung und klare Steuerung anhand von Service Levels.
Data und Technology
- Anwendungsfälle: Datenhaltung im Lakehouse, strukturierte Wissensbasen für die Textgenerierung, automatisierte Qualitätsprüfungen, Schutz von personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen, Monitoring und Auswertung der Modellqualität.
- Nutzen: Schnellere Umsetzung, geringere Risiken bei Modellen und Anbietern und bessere Skalierbarkeit.
Rollen und Skills
Rollen mit sinkendem Routineanteil: standardisierte Reportproduktion, einfache RFP-Texte, Junior Extraktion und manuelle Pre-Trade-Vorbereitung.
Rollen mit steigender Nachfrage: AI-Product-Owner, MLOps und AI-Engineers, Model Risk Manager, Compliance-Spezialisten für KI, Data Stewards sowie Hybrid-Analystinnen und -Analysten mit Domänenwissen und KI-Werkzeugen.
Wandel in bestehenden Rollen: Portfolio-Management, Research und Investor Relations verschieben sich in Richtung Orchestrierung, Qualitätssicherung und Erklärung. Es wird weniger gesucht und gesammelt, dafür mehr entschieden.
Governance und Regulatorik
Die Unternehmensleitung bleibt verantwortlich. MiFID-Pflichten gelten unverändert, auch wenn KI eingesetzt wird. Nötig sind klare Richtlinien, ein Modellregister mit Zweck, Daten, Risiken und Messgrößen, Verfahren zur menschlichen Kontrolle und dokumentierte Freigaben. Risiken durch externe Anbieter werden über Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, über Audit-Rechte und über Ausstiegsklauseln gesteuert. In der Europäischen Union wächst der Pflichtenumfang schrittweise. Der Rahmen reicht von allgemeinen Governance-Regeln über Anforderungen an sehr leistungsfähige Modelle bis zu besonders strengen Vorgaben für Hochrisiko-Systeme.
Umsetzung in vier Phasen
Phase null bis eins: Zielbild und Kontrollen. Use Cases nach Wirkung und Umsetzbarkeit priorisieren. Datenquellen und Datenqualität prüfen. Richtlinien zu Daten, zu personenbezogenen Informationen, zu Prompts, zu Tests und zu Logging festlegen. Modellregister und Freigabeschritte definieren.
Phase zwei: Plattform und Piloten. Aufbau eines Minimum Viable Product für die Plattform. Dazu gehören eine kuratierte Wissensbasis, eine Pipeline für Qualitätstests und Sicherheitsregeln sowie eine Abstraktionsschicht für unterschiedliche Modellanbieter. Drei Piloten eignen sich besonders: RFP und DDQ, Meeting-Debriefs mit CRM-Übergabe sowie ein Research-Copilot.
Phase drei: Rollout und Re-Design. Skalierung im Front Office, Aufbau einer Reportingfabrik mit Validierungen und Versionierung, Umstellung von Risk und Compliance auf kontinuierliche Absicherung.
Phase vier: agentische Ende-zu-Ende-Ketten (E2E). Durchgängige Ketten von der Datenerhebung bis zur Investorenerklärung, jeweils mit Audit-Trail, Qualitätskontrollen und klaren Rollen. Parallel läuft ein Programm für breit angelegte Weiterbildung.
Kennzahlen und Business Case
Richtwerte für das erste Jahr, die sich in vielen Häusern beobachten lassen. RFP und DDQ werden deutlich schneller, die Durchlaufzeit sinkt oft um ein Drittel bis zur Hälfte. Client Reporting wird zügiger und fehlerärmer. Research-Zyklen verkürzen sich um etwa ein Viertel bis ein Drittel, die inhaltliche Abdeckung je Person steigt. Relationship-Manager verbringen mehr Zeit mit Kunden. Compliance reduziert Backlogs ohne Qualitätsverlust. Die Kosten für eine erste Plattform mit drei bis fünf Kernfällen liegen häufig im mittleren sechsstelligen Bereich pro Jahr. Der Betrag hängt stark von Volumen und Nutzung ab.
Risiken und Gegenmaßnahmen
Faktentreue: Modelle können plausibel formulieren und dennoch irren. Abhilfe schaffen kuratierte Quellen, eine Verpflichtung zum Zitieren, automatische Qualitätsprüfungen und ein Freigabeprozess.
Datenschutz: Personenbezogene Daten müssen erkannt und geschützt werden. Dazu gehören Scanner, klare Datenklassen, Rechtekonzepte und Schulungen.
Abhängigkeit von Anbietern: Gegen Lock-in helfen eine Abstraktionsschicht, Portabilitätsklauseln und ein definierter Exit-Plan.
Modellqualität über die Zeit: Daten und Nutzung verändern Modelle. Monitoring und regelmäßige Neubewertung sind Pflicht.
Reputation und Compliance: Die menschliche Freigabe, Belastungstests und Krisenpläne senken das Risiko.
Pragmatisch starten
Erstens: Richten Sie einen Wissenshub für RFP und DDQ ein und erzeugen Sie erste Entwürfe mit anschließender Compliance-Prüfung. Zweitens: Erfassen Sie Meeting-Inhalte strukturiert und überführen Sie sie automatisch ins CRM, inklusive Aufgaben und E-Mail-Entwürfen. Drittens: Führen Sie einen Research-Copilot für Transkripte, Prospekte und Studien mit sauberem Quellenpfad ein. Viertens: Bauen Sie ein schlankes System für Client-Reporting und Kommentare mit klarer Versionierung auf. Fünftens: Setzen Sie eine Erstprüfung für Marketingunterlagen auf Basis Ihrer Stil und Regelleitlinien auf.
Fazit
KI ist kein Selbstzweck. Wert entsteht, wenn Daten, Governance und Zielbild zusammenpassen und wenn Prozesse bewusst neu gestaltet werden. Wer jetzt startet, realisiert vermutlich spürbare Produktivitäts- und Qualitätsgewinne und bleibt gleichzeitig anschlussfähig für die nächste Ausbaustufe. (csa)
Glossar der wichtigsten Begriffe
Copilot. Ein Assistenzsystem auf Basis von Sprachmodellen, das Vorschläge macht, Texte erstellt, zusammenfasst oder bei Analysen hilft.
RFP und DDQ. Request for Proposal und Due -Diligence Questionnaire. Standardisierte Anfragen institutioneller Investoren nach Leistungsversprechen und Detailinformationen.
CRM. Customer Relationship Management. System zur Verwaltung von Kontakten, Aktivitäten und Vertriebschancen.
KID und KIID. Key Information Document unter der PRIIPs -erordnung und Key Investor Information Document im UCITS Kontext. Standardisierte Anlegerinformationen.
SFDR und Taxonomie. Offenlegungsverordnung und EU -Taxonomie. Regulatorische Vorgaben zu Nachhaltigkeitsangaben und zur Einordnung von Wirtschaftstätigkeiten.
MiFID. Markets in Financial Instruments Directive. Europäischer Rahmen für Wertpapierdienstleistungen, der unter anderem Anlegerschutz und organisatorische Pflichten regelt.
Agenten. Softwaremodule, die mehrere Schritte selbstständig ausführen, zum Beispiel Informationen beschaffen, vergleichen und vorbereiten. Menschen setzen Ziele und prüfen Ergebnisse.
RAG. Retrieval-Augmented Generation. Technik, bei der ein Modell vor dem Antworten passende Dokumente aus einer Wissensbasis sucht und diese in die Antwort einbezieht.
Lakehouse. Datenarchitektur, die die Offenheit eines Data Lakes mit der Struktur eines Data Warehouses verbindet.
Feature Store. System, das berechnete Merkmale für Modelle speichert und wiederverwendbar macht.
TCA. Transaction Cost Analysis. Verfahren zur Messung und Auswertung von Handelskosten.
OMS und EMS. Order-Management-System und Execution-Management-System. Systeme zur Ordererfassung und zur Ausführung im Handel.
Explainability. Nachvollziehbarkeit von Modellen und Entscheidungen.
Bias. Systematische Verzerrung in Daten oder Modellen, die Ergebnisse verfälschen kann.
Drift. Veränderung von Daten oder Modellen über die Zeit, die zu Qualitätsverlust führt.
Human in the loop. Vorgehen, bei dem Menschen Ausgaben eines Modells prüfen, korrigieren und final freigeben.
Audit Trail. Lückenlose Nachvollziehbarkeit der Erstellung, Änderung und Freigabe von Inhalten und Entscheidungen.